Heinrich Krieg
Erinnerungen aus meiner Kindheit
Gaggenau – Bad Rotenfels, im Winter 1992/93
 Meine Familie aus Anlass der Silbernen Hochzeit meiner Eltern 1932. Ich bin rechts außen.
Meine Familie aus Anlass der Silbernen Hochzeit meiner Eltern 1932. Ich bin rechts außen.
Am 10. September 1919 wurde ich als sechstes von sieben Kindern der Eheleute Heinrich und Rosa Krieg geboren, nachdem mein Vater verwundet aus dem 1. Weltkrieg heimkehrte. Ein Granatsplitter hatte ihm in der rechten Kniekehle die Schlagader verletzt. Durch die herrschende Kälte war das Blut sofort geronnen und verhinderte so, dass er verblutete. Dies weiß ich noch aus Erzählungen. Ich kann mich erinnern, dass er in einer Kniekehle auch einen großen Krampfaderknochen hatte, der ihn oft juckte und er deshalb dort kratzen musste.
Schade, dass man als Kind oder Jugendlicher noch nicht das Interesse aufbringt, näher nachzufragen. Heute – als 73-jähriger und nachdem mein Vater schon fast 48 Jahre tot ist, bedauere ich das sehr. Warum nur habe ich nicht gefragt, solange mir mein Vater noch hätte antworten können, was er sicher auch gerne getan hätte? Erst vor einigen Tagen sagte ich zu einem jungen Mann, als wir uns über vergangene Zeiten unterhielten: „Frage die Alten, solange sie Dir noch antworten können, morgen schon könnte es zu spät sein!“

Bei uns zuhause im Hof etwa 1925. Ich bin der Kleine links.
(Das Gebäude ganz rechts im Bild ist eine Ecke der heute noch stehenden Alten Wagnerei. Alles andere ist beim Angriff auf Gaggenau mit Daimler-Benz Werk am 10.09.1944 – meinem 25. Geburtstag – abgebrannt. Das Gebäude auf der anderen Straßenseite mit dem im Ganzen zu sehenden Fenster ist das Altgeding des in der Rathausstraße gegenüber stehenden alten Bauernhofes. Dort wohnte der letzte Fuhrmann der Gemeinde. Heute ist es – mit dem gesamten Anwesen – renoviert. Auch die 2-farbige Gebäudeecke rechts daneben gehört zu dem heute noch stehenden Anwesen Fütterer – früher Mostmacher und Lebensmittelfachgeschäft – und enthält heute den cap-Markt.)
Meine Kindheit verlief unter der umsorgenden und beschützenden Liebe der Eltern zwischen Wohnung, Kuhstall, Werkstatt und Feld. Ich erinnere mich noch gut, wie ich als kleiner „Springer“ oft beim Vater zur Futterzeit im Stall war und mir die Mutter durch den Stallladen (eine Durchreiche mit Laden – Klappe oder Türle – von der Küche in den Stall) eine Tasse reichte, die mir dann der Vater beim Melken mit Milch füllte. So hatte ich oft eine extra Portion Milch auf dem direktesten Weg. Als dann meine jüngste Schwester Sofie ihre Füßchen gebrauchen konnte, war auch sie mit dabei und nahm ihre extra Portion kuhwarme Milch in Empfang. Vater lehrte uns so schon sehr früh ein schönes Verhältnis zu den Tieren auf dem Hof: Kühe, Rinder, Kälbchen, Geißen (Ziegen), Hühner und Sauen.
Aber auch in der Werkstatt durften wir spielen. So haben wir, wenn die Maschinen außer Betrieb waren, an der Bandsäge mit Sägemehl Kuchen gebacken.
Anekdoten
Leiter klettern
Eines Tages hatte mein Vater eine neue Steigleiter fertig gemacht und stellte sie am Schopf (Scheune) an den Dachkanal. Ich war etwa 4 Jahre alt. Meine Eltern und Geschwister waren beim Vesper und ich auf Erkundung. Ich wollte wissen, wie die Welt von oben aussieht. Ich kletterte die Leiter hoch. In diesem Moment fiel es auf, dass ich mich davon gemacht hatte. Eine meiner Schwestern sah mich auf der 5 m hohen Leiter und sagte es Vater. Der meinte: „Nicht rufen!“, stieg langsam die Leiter hoch und sagte: „Heinrich, bleib schön oben, ich hol Dich“. Das war mein erster Ausflug in höhere Regionen.
Kühe
Als ich noch kleiner war, bin ich eines Tages die Hausstaffel (Außentreppe zur Haustür) runter gefallen und lag schreiend im Hof. In diesem Moment kamen die Kühe aus dem Grasgarten, wo sie beim Weiden waren (wir hatten beim Anwesen mitten im Ort etwa 2000 m2 Obstwiese, die zur Versorgung von Menschen und Haustieren wichtig waren). Zuerst blieben sie stehen und betrachteten das schreiende Wesen am Boden, dann gingen sie mit großen Schritten über mich hinweg. Ich weiß bestimmt, dass ich für sie nicht nur ein Hindernis bedeutete, sondern dass sie mich kannten und wussten, dass ich dazu gehöre.
Schnapsbrennerei
Mein Vater betrieb auch eine Schnapsbrennerei und brannte für Kunden 2 bis 4 mal im Jahr Schnaps: Kirschen, Zwetschgen, Birnen oder was auch sonst so anfiel und üblich war. Im Spätjahr ging das neben der anderen Arbeit her vier bis sechs Wochen lang am Stück, manchmal mit Sondergenehmigung von 6 Uhr bis 22 Uhr, auch in Ausnahmefällen bis 24 Uhr. Die ausgekochte “Schlempe” (Maischerückstände) wollte er nicht immer im Senkloch (Jauchegrube) oder auf dem Misthaufen haben und so hat er diese ab und zu mit einem eigens dafür angefertigten Kastenschubkarren, der genau unter den Auslauf der Brennblase passte, in den Grasgarten gefahren. Und – wie Kinder so sind – sind sie überall dort, wo man sie am wenigsten erwartet und brauchen kann. Bei meinem Herumspringen im Garten merkte ich wohl gleich, aber zu spät, dass ich mit einem Fuß in die noch heiße „Brennich“ getreten war. Auf einem Fuß hopsend und schreiend: „Heiße Hennich `dapt, heiße Hennich `dapt!“ eilte ich dem Haus zu, wo meine Mutter Schuh und Strumpf auszog und dem Brandschmerz abhalf. Noch heute ist am rechten Fuß hinter den Zehen die Stelle erkennbar, wo damals die taubeneigroße Brandblase war.
Kühe
Größer geworden und schulpflichtig, war es meine Aufgabe, beim Stalldienst mitzuhelfen. Es waren Arbeiten, die ich meinem Alter entsprechend tun konnte. Zuerst bekamen die Kühe von der Scheuer aus Futter in die Raufe. Diese war die leiterähnliche Konstruktion, die – schräg an der Wand angebracht – das Langfutter aufnahm (Heu). Darunter war die “Kripf”, der durchgehende Trog, in den die Reste aus der Raufe fielen und in den das sogenannte Kurzfutter kam. Im Spätjahr und Winter, wenn es kein Grünfutter mehr gab, wurden auf der Rübenmühle die Dickrüben gemahlen, mit gehäckseltem Stroh vermischt und manchmal mit Kleie angereichert (Kleie ist das, was beim Mahlen von Mehl als Abfall übrig bleibt). Das Vermischen mit Stroh hat den Effekt, dass die kalten Rüben nicht zu schnell gefressen werden, was Magen- und Darmschwierigkeiten vorbeugt.
Die Kühe standen ja nicht nur im Stall, sondern waren auch Arbeitstiere. Damit in arbeitsreichen Zeiten der Milchertrag nicht zu sehr schrumpfte, wurde in Eimern Schrot oder Leinsamenkuchen angebrüht und den schwer arbeitenden und frischmelkigen Kühen verabreicht. Man musste ja auch den Eigenbedarf der Familie an Milch, Käse und Butter im Auge haben und war darüber hinaus auf den Ertrag aus dem Milchverkauf angewiesen.
Nach dem ersten Füttern wurde der Stall ausgemistet. Die Kühe, die sich mit dem Hinterteil in den Kuhmist gelegt hatten, bekamen die Arschbacken mit einer alten Sense abgeschabt. Wenn erforderlich, wurden sie mit Wasser abgewaschen. Auch die Schwänze wurden in einem Eimer abgewaschen, wenn sie voller Kuhdreck waren. Wenn es zeitlich möglich war, hat man auch die Schwanzquaste zu Zöpfen geflochten, besonders gern dann, wenn man im Herbst mit dem Vieh auf die Weide ging.
Aber zurück zum Futterdienst: Inzwischen war die erste Raufe voll Futter leergefressen und es wurde zum zweiten Mal aufgesteckt. Zwischendurch wurde jedem Tier mit einem Eimer Wasser gegeben.
Nun war das Melken an der Reihe. Zuerst wurden die Euter gewaschen, damit kein Dreck in die Melkeimer gelangen konnte. Das Waschen war zugleich Eutermassage, was die Milchergiebigkeit förderte. Ich war noch in der Schule, als mir der Vater das Melken beibrachte. Darauf war ich stolz.
Nach dem Kurzfutter kommt nochmals Futter in die Raufe und es wird nochmals Wasser angeboten. Danach wird Stroh geschnitten und neu eingestreut. Zum Schluss werden die Tiere geputzt (gebürstet). Das war oft schön, wenn die Tiere zeigten, wo es sie juckte, indem sie den Kopf hochhielten, damit man sie am Hals bürsten konnte, oder den Kopf herunter nahmen, damit man ihnen hinter den Hörnern kraulen konnte. Wenn man sie auf dem Rücken bürstete, konnte es vorkommen, dass sie das Hinterteil ganz herum bogen, um zu zeigen, wo ihnen das Bürsten gut tat.
Es sind zwar nur Tiere, aber sie merken, wenn man sie gut behandelt und danken es auf ihre Art. Ich durfte schon als Schulbub junge Rinder in den Hof oder in den Grasgarten nehmen. Dort konnte ich sie frei laufen lassen und wenn ich ihnen rief, kamen sie wie Hündchen. Auch auf der Straße ließ ich sie frei laufen, sie rannten dann ein Stück weg und kamen wieder zurück. Dies ist natürlich nur möglich, wenn Vertrauen, ich möchte fast sagen, Liebe, im Spiel ist. Dieses Verhältnis lehrte uns der Vater durch sein Beispiel.

Heinrich Krieg im Frühjahr 1953 (etwa) mit “Gretl” und “Mohrle” am Gespann vor der Werkstatt. Die erste Ausbaustufe des Hauses ist im Rohbau fertig und wir waren schon eingezogen. Zwischen uns und der Rathausstraße ist ein Trümmergrundstück und die Eisenbahnstraße gibt es noch nicht.
Mähen
Den Sommer über musste alle zwei oder drei Tage auf dem Feld Grünfutter geholt werden. Der Vater fuhr mit dem Fahrrad voraus, nahm die Sense mit und begann mit dem Mähen. Wir Kinder brachten mit den Kühen den Wagen nach, um das Futter aufzuladen. Wenn Klee zu holen war, konnten wir die Kühe ohne “hist” und “hottrum” frei laufen lassen, den Kleeacker fanden sie alleine. Als Sofie und ich noch klein waren und die Mutter die größeren Kinder daheim zur Arbeit brauchte, nahm der Vater uns zwei mit dem Wagen mit, damit wir daheim der Mutter vom Rockzipfel weg waren. Wenn das Futter aufgeladen war, machte er im Futter oben eine Mulde, legte einen Sack hinein und setzte uns rein. Im Spätjahr, wenn es früh dunkel wurde, sang er uns auf dem Heimweg oft vom Mond und den Sternlein vor oder erzählte uns Geschichten. Die Kühe wussten, wo ihr Stall war.

Öhmd-Ernte (“Ohmed”) 1953 in der Itterbach. Heinrich Krieg mit Frau Anna und als Helfer der Neffe Walter Hirth
Zackern und Eggen
Größer geworden, mussten – durften – wir dann beim Eggen oder “Zackern” (Pflügen) die Kühe führen. Dies beschränkte sich hauptsächlich auf das Umkehren an den Ackerenden. Im Übrigen waren die Kühe so gut eingefahren, dass es nur den Zurufen des Vaters bedurfte. Manchmal gab er mir den Pflug in die Hand und machte selbst den Vorgehbub. Das machte mich dann richtig stolz. Wenn ein Acker zu zackern war, mit gut eingefahrenen Kühen, so war dies oft die Gelegenheit, die Vater benutzte, von früher zu erzählen oder von seinen Lebenserfahrungen.

Frühjahr 1953: Eggen des Kartoffelackers auf der Hub. Anna Krieg mit Neffe Klaus Bracht, der die Kühe führt.
Anlernen von jungen Kühen
Schwieriger war es, wenn ein junges Tier angelernt werden musste. Man spannte den Anlernling mit einer alten, zuverlässigen, gut eingefahrenen Kuh zusammen an den Wagen. Für solche Erstlingsfahrten wurden natürlich nur leichte Fuhren auf ebenen Wegstrecken gewählt, sodass das Ziehen des Wagens von der Leitkuh alleine mühelos bewältigt werden konnte. Zudem wurde der Waagbalken auf der Seite der Leitkuh mit einer Kette zurückgehängt, womit das Zugspiel der zwei Tiere ausgeschaltet war und das Jungtier die Last des Wagens nur zu spüren bekam, wenn es vorpreschte. Zudem wurde dem Anlernling ein sogenannter “Laufzügel” angelegt, den es beim Vorpreschen unangenehm zu spüren bekam. So versuchte man, dem Lehrling das Anpassen an die Gangart der Leitkuh beizubringen. Gerne hat man für die anfänglichen Fuhren das Futterholen gewählt, sodass dem Lehrling neben dem Anpassen und Einfügen an der Deichsel auf dem Kleeacker oder der Wiese etwas Saftiges ud Wohlschmeckendes für den Gaumen als Lohn geboten wurde. Mit solchen, mit Fingerspitzengefühl angewandten Methoden, dauerte es nicht lange, bis ein Jungtier angelernt war.
“Bräme jage”
Weniger schön war es im Sommer beim Heuholen oder in der Getreideernte. Wir Kleinen, die sonst noch nicht viel helfen konnten, mussten dann bei dem Fuhrwerk bleiben und immer weiter vorfahren und – was noch wichtiger war – den von Bremsen und Mücken umschwärmten Kühen diese Plagegeister vom Leib halten. Dabei hätten wir mit dieser Arbeit bei uns selbst genug zu tun gehabt. Ganz schlimm war dies bei schwülem Wetter. Da stampften die Kühe mit den Füßen, schlugen mit dem Schwanz um sich und “wispelten” mit dem Kopf (warfen diesen hin und her). Wie dankbar die Kühe für das Bremsenjagen waren, sah man, wenn sie mir den dicht an dicht mit “Bräme” besetzten Hals hinhielten, damit ich mit einer Hand voller Zweigen diese Quälgeister verjagen konnte. Mit dieser Arbeit, die uns – mir – der Vater zudachte, lehrte er uns nicht nur Selbstbeherrschung, sondern auch Gefühl für die Tiere.

Öhmd-Ernte (“Ohmed”) am 01.09.1953 in der Dachgrub (jetzt Standort der Schule). Oben auf dem Wagen Heinrich Krieg, beim “Abrechen” des Wagens (Entfernung von losem Heu mit Hilfe eines Rechens) Rosa Hirth. Die Kinder sind Franzjörg Krieg, Margret Hirth und Eva Krieg.

Heinrich Krieg setzt den Wiesbaum, der von oben auf das Heu gespannt wird und damit die Beladung nach unten festhält. Unten: Franzjörg, Margret Hirth, Eva und – vorne bei den Kühen – Rosa Hirth.
Heuernte
Zur Zeit der Heuernte wurde bei guter Witterung natürlich so viel als möglich Heugras gemäht. Natürlich mit der Sense, denn Mähmaschinen standen noch keine zur Verfügung, und wenn, dann hätte man sich die Anschaffung nicht leisten können. Zu dieser Arbeit hatte mein Vater oft einige Helfer bestellt. Zum Beispiel arbeitslose Taglöhner, die mähen konnten, oder solche, die bei uns ihre Milch holten. Da konnte es vorkommen, dass vier, fünf oder sechs Mäher hintereinander standen. So “gab es dann ein Stück”.
Diese Helfer kamen gern, gab es doch neben dem Lohn (oft in Form von Naturalien) auch gutes Essen und Trinken, woran nicht gespart wurde. So war neben dem Vesper immer Trinkbares, z.B. Most oder leicht gezuckertes Wasser mit einem kleinen Schuss Schnaps dabei. Wenn z.B. in der Itterbach gemäht wurde, wurden die Flaschen in den sprudelnden Bach gelegt und jeder konnte sich, wenn er mit seiner Mahd am Bach ankam, bedienen. Auch frische, rohe Eier waren dabei, die zwischendurch ausgetrunken werden konnten. Am Wochenende wurde so viel Heu eingefahren, als dürr genug und zeitbedingt möglich war. Dabei musste mithelfen, was Hände und Füße hatte. Oft blieben dann am Samstagabend noch zwei Wagen voll Heu stehen, die dann am Sonntagmorgen abgeladen werden mussten. Die Aufgabe der Kleinsten war es – weil sie sonst zu nichts Besserem zu gebrauchen waren, sie aber trotzdem das Einfügen in den Arbeitsprozess lernen mussten – auf dem Heustock das Heu zu “treppeln” (trampeln, festtreten) und am Dach runter zu stopfen. Weil wir kleinen “Hensching” (Handschuhe) dazu aber doch noch zu leicht waren, ging hinterher der Vater selbst auf den Heustock und verbesserte, was wir Kleinen noch nicht richtig fertig brachten.

Heuernte um 1940 mit Heinrich (senior) und Rosa Krieg (senior) und Josefine Krieg (verh. Bracht) bei den Kühen
Im Großen und Ganzen wurde bei uns der Sonntag eingehalten. Da man aber, insbesondere in der Heu- und Getreideernte, vom Wetter abhängig war, konnte es vorkommen, dass der Pfarrer am Sonntagmorgen in der Kirche diesbezügliche Arbeiten erlaubte. Es drehte sich dann um das Heuwenden, Häufeln oder Einfahren. Letzteres insbesondere, wenn Wetterverschlechterung in Aussicht war. Gemäht wurde am Sonntag nicht.
Getreideernte
Bei der Getreideernte war es die Arbeit der Kleinen, Garbenstricke (“Ährestrickle”) zu legen, auf die dann jeweils drei Arme voll Getreide gelegt wurden (antragen), nachdem es zuvor mit dem Getreiderechen aufgerechelt worden war. Danach wurden die Garben gebunden. Dies tat meistens der Vater oder ein anderer Erwachsener, dem man das feste Binden der Garben zutrauen konnte. Dabei durfte auch ein Kind helfen, und zwar durch das Hochhalten der Hölzchen am Ende der Garbenstricke. Hinter dem Aufladen her wurde das Liegengebliebene “nachgerechelt” und hinterher kamen die Kleinen wieder zum Einsatz. Trotz des Rechelns blieben noch ab und zu Ähren liegen. Diese wurden zusammengelesen und mit Stroh zu Sträußchen gebunden. Für jedes Sträußchen bekamen die Kinder ein paar Pfennige. So hat man versucht, uns beizubringen, dass jede Ähre wertvoll ist, beinhaltet sie doch Körner, die zu Mehl gemahlen und zu Brot gebacken werden.

Getreideernte um 1940. Heinrich Krieg (senior) mit seinen beiden Töchtern Sofie und Agatha.
“Waidle”
Nach der Getreideernte kam die Öhmdernte (“Ohmed”) und, weil es nun schon dem Spätjahr zuging und das Gras je nach Witterung nicht mehr so schnell nachwuchs, als dass sich ein nochmaldiges Mähen für Grünfutter rentieren könnte, ging man mit dem Vieh ins Weiden (“Waidle”). Dies war, weil man während der Woche bei guter Witterung die Arbeitskühe brauchte, meistens am Sonntagnachmittag. Im Hof wurden die Tiere mit den Halsketten zusammengehängt und auf der Weide wieder los gemacht. Die Ketten blieben lang hängen, sodass junge, wohllüstige Tiere, die nicht vom Arbeiten müde waren, durch die hängende Kette beim Abhauen gehindert wurden. Aufzupassen war nur, dass die Tiere auf der eigenen Wiese blieben. Wenn sie vollgefressen waren und es der Melkzeit zuging, konnte es sein, dass die Kühe muhten und so zeigten, dass sie heim wollten. Das Zusammenhängen mit den Halsketten war dann nicht schwer, wollten sie doch in den Stall. Die jungen Tiere, die die Freiheit noch genießen wollten, ließ man gewähren. Wenn sie sahen, dass die Alten auf den Heimweg gingen, kamen sie von selbst nachgelaufen.
Bubenzeit
Nun wieder zurück zu meiner Bubenzeit.
Ich war vielleicht dreieinhalb Jahre alt, als meine Mutter versuchte, mich in die Kinderschule zu bringen. Das war aber nichts für meinem Vater seinen Bub. Mit “Rumspenzle” war da nichts drin und das Still-Hinsitzen und die Hände brav auf den Tisch legen war auch nicht meine starke Seite. Ich glaube, ich hielt es keine drei Tage aus. Viel lieber suchte ich daheim im Laubschopf, in der Scheuer, im Heustall oder Holzschopf nach Hühnernestern oder “spengelte” mit Nachbarsbuben rum oder wir machten “Fangerles” oder “Sucherles”.
S’ Kretze
Unsere nächsten Nachbarn waren ein altes Ehepaar, über deren Hof wir ein Überfahrtsrecht hatten. Ich ging bei ihnen ein und aus. Sie wohnten in einem alten, zweistöckigen Fachwerkhaus, dessen Wände zum Teil ziemlich schief waren. So auch die Wand zwischen Gang und Wohnzimmer. Ich kleiner “Stumpen” war gerade so groß, dass ich, auf den Zehen stehend, mit den Fingerspitzen die Türfalle (Klinke) der nach innen hängenden Tür herunterziehen konnte. Nun nahm das Schicksal seinen Lauf. Hinter der Tür, neben dem Ofen, saß nämlich der alte Kretze-Fritz in einem Lehnstuhl. Diesem alten Mann schlug die nach innen hängende Tür auf die Knochen. Wohlwissend, was jetzt kommt, suchte ich schnurstracks das Weite und die alte Frau Kretz, schimpfend mit den Worten: “Du Sapperlotter!” hinterher.
Diese Frau Kretz war sehr neugierig und so verging fast kein Tag, an dem sie nicht mit irgend einer Ausrede kurz vor oder während dem Mittagessen kam, wollte sie doch wissen, was bei uns auf den Tisch kam. Dies “nickelte” natürlich meine Eltern. Eines Tages – wir waren gerade beim Mittagessen und die Frau Kretz war noch nicht da – sagte mein Vater zu mir: “Heinrich, geh vor zur Frau Kretz und sag ihr, dass wir essen”. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht gerade der folgsamste Bub war, aber diese Aufgabe ließ ich mir nicht entgehen. Schon von Weitem rief ich ihr zu: “Frau Kretz, wir essen!”
Schlittenfahren am Murgdamm
Eine kleine Episode im Winter. Ich war vielleicht sieben Jahre alt und Sofie war fünf. Es lag Schnee. Diese Tatsache wollten wir ausnutzen, schnappten uns den Schlitten und weg waren wir. Ich, wohlgemerkt, in Halbholzschuhen. Ob wir fort dürfen, haben wir natürlich nicht gefragt, denn dann wäre nichts drin gewesen, schon gar nicht mit Halbholzschuhen. Unser Ziel: Der Badsteg. Mit jedem Schritt blieb Schnee an den Holzschuhen kleben und alle paar Meter musste ich die Stollen von den Holzschuhen klopfen. Hätte man von mir verlangt, dass ich auf diese Weise im Schnee laufen müsse, hätte ich wohl ein dummes Gesicht gemacht. Aber so?!
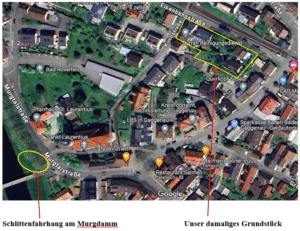
Nun, wir kamen an unser Ziel. Andere Kinder waren schon feste dabei. Hei, war das schön! Wir setzten oben an der Brücke an, fuhren den Abhang hinunter, eine Rechtskurve, den Murgdamm hinunter und über das Murgvorland der Murg zu. Mit jeder Tour lief es besser. Ich hatte nur Schwierigkeiten beim Schlittenhochziehen mit den Schneestollen an den Holzschuhen. Aber das Schlittenfahren machte Spaß. Im Eifer des Gefechts habe ich dann nicht früh genug gebremst und schon war es passiert: Wir standen im Wasser bis an die Waden. Den Schlitten hatte ich fest in der Hand, aber die Holzschuhe waren nicht angebunden und einer blieb in der Murg zurück. Mit nur einem Halbholzschuh, nassen, frierenden Füßen und sehr schlechtem Gewissen ging es nachhause, an der Kirche vorbei, das kurze Stück durch s’Kirchgässle und durch das untere Gartentor auf unser Grundstück. In der Werkstatt warteten wir am warmen Ofen bis der Vater kam. An das, was es dann absetzte, kann ich mich nicht mehr erinnern. Die Angst und das schlechte Gewissen waren wohl bedeutender. Wenn uns der Vater, besonders mir als dem älteren Kind, mit der flachen Hand (und die war nicht gerade klein!) das Hinterteil angewärmt hätte, wäre es wohl verdient gewesen. Die Mutter wunderte sich nur, weil von mir nur noch ein Halbholzschuh da war. Ich habe die Geschichte auf jeden Fall bis heute nicht vergessen.
“d’Schleifez”
Ein anderes Mal, auch im Winter und der Dorfbach (offener Gommersbach, der durch die jetzige Hindenburgstraße und an der Schule entlang führte) war zugefroren, sind alle Schulkinder in der Bach “geschliffen”. Dies war ein lustiges, tolles Treiben. Ich hatte vielleicht genagelte Schuhe an, auf jeden Fall war ich schneller als das Mädchen vor mir, und da war es geschehen. Ich stürzte und am rechten Oberkiefer war eine Lücke. Der Eckzahn war abgebrochen. Erst nach vielen Jahren wurde dies mit einem Stiftzahn repariert.
Böser Lausbubenstreich
Ein anderes Stückchen aus meiner Kinderzeit, das ich nie vergessen werde:
Es zeigt, wie sehr man als Kind die Freude und den Spaß im Auge hat, aber nicht die Gefahr, die dahinter für sich selbst oder auch für andere lauert.
Es war auch im Winter. Ich war vielleicht im fünften Schuljahr. Wir hatten beim Lehrer Webel nachmittags von 2 bis 3 Uhr Zeichnen. Ich ging daheim mit Zeichenblock, Bleistift, usw. zum Hof raus und sah, dass von vorn in der Rathausstraße die Hauptsträßler kamen, die Schüler unserer Klasse aus der Hauptstraße und der Großau, die damals noch Maurergasse (Muregass) hieß.
(Unser Grundstück grenzte direkt an die Bahn und erstreckte sich von der Rathausstraße bis zur Kirchstraße. Ich konnte also entweder durch die Hofausfahrt und über die Rathausstraße zur Schule oder durch unseren Obstgarten und den Bahnübergang der Kirchstraße direkt zur Schule.)
Wir gingen zusammen über den Bahnübergang in die untere Hindenburgstraße, am Bach entlang. Als wir ums “Laube-Eck” gingen, schaute ich nochmals zurück und sah, dass der Milchwagen vom Winklerhof kam. Ein Knecht vom Winklerhof brachte morgens mit einem leichten Pritschenwagen und einem Gaul die Milch zur Sammelstelle und machte noch andere Besorgungen. Etwa um 13.30 Uhr kam er auf dem Heimweg durch die Rathausstraße. Wir rannten dann in den nächsten Hof (s’Sigmunde Hof) und machten Schneeballen. Zur besseren Übersicht muss gesagt sein, dass damals mitten durch die jetzige Hindenburgstraße der Dorfbach (Gommersbach) lief. Inzwischen ist der Bach schon lange verdolt und verläuft unter der Straße. Auf beiden Seiten des Baches war eine 80 – 100 cm hohe Mauer, die oben straßeneben verlief. Als der Milchwagen vor dem Hof vorbei fuhr, prasselte eine Salve von Schneeballen auf das Pferd und den Wagen. Wir kamen aus dem Hof heraus und ich sah noch, wie ein Hinterrad des Wagens ganz knapp am Abbruch in den Bach vorbei zog. Das hätte böse ausgehen können!
Zur gleichen Zeit sahen wir auch unseren Lehrer Webel am offenen Schulzimmerfenster stehen. Er hatte natürlich unseren bösen Bubenstreich beobachtet. Lammfromm, als könnten wir kein Wässerchen trüben, trotteten wir zur Schule. Dort angekommen, kam uns ein Schüler entgegegen mit den Worten: “Ihr sollt alle gleich hochkommen zum Lehrer Webel!” Nun wussten wir, was es geschlagen hatte. Der erste, der raufkam, bekam den Auftrag, in dem daneben ligenden Zimmer das “Schafott” zu holen. Dort war nämlich die Gewerbeschule untergebracht und anstelle der Kombinations-Schulbänke gab es dort Tische und Hocker. Über einen solchen Hocker wurde Einer nach dem Anderen gelegt und pfeifend und klatschend fand das Meerrohr seinen strafenden Weg – auch neben die vorher in die Hosen gesteckten Zeichenblöcke. Das war dann Erziehungsunterricht. Und das wohlverdient. Eine solche Schneeballschlacht leisteten wir uns nie mehr. Das hätte für Fahrer, Pferd und Wagen böse enden können. Ein wachsamer Schutzengel hatte da seine Hände mit im Spiel.
Solche handfesten Eingriffe in die Erziehung hatte diesem Lehrer damals niemand übel genommen. Im Gegenteil. Reklamationen von Elternseite hat es nie gegeben, weil alle froh darüber waren, dass auch die Schule Erziehungsverantwortung übernahm. Das Miterziehen in allen Bereichen der Gesellschaft war damals noch weit verbreitet. Außerdem war jeder Schüler froh, wenn die Sache damit erledigt war und die eigenen Eltern möglicherweise nie davon erfuhren. Es hätte sonst noch zuhause eine Zugabe gegeben…
Lehrer Webel
Der Lehrer Webel war ein sehr guter Zeichenlehrer. Er lehrte uns, wie man mit ausgestrecktem Arm, den Bleistift zwischen Daumen und Zeigefinder, Länge, Breite und Höhe eines Gegenstandes oder eines Tieres abmaß und dies dann auf das Papier übertrug. So gab er uns eines Tages die Aufgabe, daheim oder in der Natur etwas zu zeichen und das nächste Mal mitzubringen. Ich setzte mich unter die Stalltür und versuchte, nach gelernter Methode eine Kuh auf Papier zu bringen. Nach öfterem Radieren und neu Beginnen gelang es mir schließlich, so dass ich selbst mit meiner Arbeit zufrieden war. Stolz brachte ich zur nächsten Zeichenstunde mein Werk mit. Nun erlebte ich etwas Niederschmetterndes. Lehrer Webel glaubte mir nicht, dass ich dies freihand gezeichnet hatte. Er wusste nämlich, dass mein Vater Vorstand im örtlichen Viehversicherungsverein war und dass er ein altes, dickes Buch hatte über Haustiere wie Pferde, Rinder Ziegen, Schweine, etc. und deren Krankheiten und entsprechenden Hilfsmaßnahmen, auch bei schweren Tiergeburten. Auch Abbildungen von allen Haustierarten waren dabei. Dieses Wissen des Lehrers war ausschlaggebend für seine Meinung. Er war sich klar, dass ich die Kühe abgepaust hatte. Das konnte ich nicht verstehen. Es tat mir weh, dass er mir nicht glaubte. Ich zeigte und erzählte dies meinem Vater. Der sagte zu mir: “Heinrich, ein schöneres Lob gibt es ja gar nicht, und merke Dir, auch der Lehrer Webel ist nur ein Mensch”.
Finderlohn
Ein anderes Wintererlebnis:
Ich glaub’, es war schon im März, aber es lag noch Schnee und man konnte noch schlittenfahren. Mit dem Roll Erich, einem Schulkameraden, war ich im Tannenwald. Wir fuhren mit dem Schlitten einen steilen Weg herunter und über den Wegrand weg ins Girrbachtal. Wie wir über den Wegrand fuhren, sah ich etwas Helles blitzen. Ich sprang gleich wieder rauf, suchte danach und fand eine runde metallene Stelle. Ich kratzte den festgefahrenen Schnee los. Es war die Rückseite einer Taschenuhr. Meine Freude war groß. Als ich sie daheim dem Vater zeigte und er mir sagte, dass ich sie nicht behalten dürfe, sondern auf das Rathaus bringen müsste, war die Freude weg. Es gab da ja aber noch die Möglichkeit, dass sich kein Verlierer melden würde.
Am anderen Morgen ging der Dorfschütz mit der Schelle durchs Dorf und gab den Fund bekannt. Der Dorfschütz war noch nicht zurück, hatte sich der Verlierer schon gemeldet und wurde zu meinem Vater geschickt. Er war ein arbeitsloser Junggeselle. Als ich von der Schule heimkam, kam er wieder und wollte von mir wissen, wo ich die Uhr gefunden hatte. Ich sollte ihm die Stelle zeigen, denn es müsste noch ein Taschenuhranhänger dabei sein. Wir gingen an den Fundplatz, kratzten die Stelle frei und fanden auch den Anhänger. Der Verlierer freute sich sehr. Er wohnte ganz in unserer Nähe, auch in der Rathausstraße. Er erzählte, dass er die Uhr schon ein halbes Jahr zuvor, also im September, verloren hatte, als er mit Freunden einen Spaziergang machte. Trotz intensivem Suchen hatten sie damals die Taschenuhr nicht mehr wiedergefunden.
Er wollte mir Finderlohn geben, aber mein Vater lehnte dies grundsätzlich ab. Zu mir sagte der Vater danach: “Heinrich, der August ist ein armer Kerl, er hat keine Eltern mehr, ist arbeitslos und muss sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagen. Nimm seine Freude, dass er die Uhr, die er längst abgeschrieben hatte, wieder bekam, als Finderlohn”.
Das war wieder ein Stück Erziehung.
